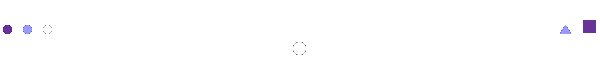| Das Raffele |
|
Aus dem mittelalterlichen "Scheitholt"
entwickelte sich als eine weitere
Vorläuferstufe |
|
unserer
heutigen Zither im 17./18.Jhdt. durch
Vergrößerung des |
|
Schall- bzw.
Resonanzkörpers und Aufleimen eines
Griffbretts die "Kratzzither". |
|
Sie behielt anfänglich noch die längliche Rechteckform des Scheitholts,
veränderte |
|
sich aber
gegen Ende des 18.Jhdt. als "Schlagzither"
zu ihrer heute noch gebräuchlichen |
|
Gestalt. Die Kratzzither wurde anstelle
mit dem Daumen (wie das Scheitholt) mit einem |
|
Plektron (Federkiel, Horn, Holzstaberl) angeschlagen bzw. "gekratzt". |
|

|
|
Mit der Kratzzither vergleichbar ist die im Allgäu verbreitete "Scherrzither"
und das |
|
tirolerisch-oberbayerische "Raffele". Sie
haben beide diatonisch angeordnete Bünde. |
|
Die "Scherrzither" ist mit zwei "e"-Saiten auf dem Griffbrett und einer dritten "e"-Saite |
|
neben dem Griffbrett, die als Bordunton
mitklingt, bezogen. |
|
Das "Raffele" hat keine Freisaiten sondern ein Griffbrett mit zwei "a"-Saiten und
einer |
|
"d"-Saite
mit 15 Bünden. Während die Finger der
linken Hand die Melodien |
|
ein- oder
mehrstimmig greifen, bringt das auf den
Zeigefinger der zur Faust geballten |
|
rechten Hand
gelegte und mit dem Daumen leicht
angepresste Plektron die Saiten |
|
durch Hin- und Herstreichen zum Klingen. Das Raffele lässt nur eine
beschränkte |
|
Melodie- und
Akkordbildung zu. Bei schnelleren
Handbewegungen entsteht ein |
|
tremoloartiger Klang. Die "rassige" Spielweise ist heute wieder sehr beliebt. |
| |
| |